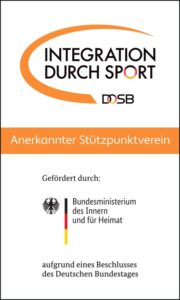Die drei Berliner Vereine Tennis Borussia, Türkiyemspor und Roter Stern Berlin stellten sich am 31.10.2012 im Weddinger Kulturzentrum KIKI SOL vor, um über ihre Besonderheiten zu berichten.
Es begann Robert von Türkiyemspor mit der Erläuterung der Entstehungsgeschichte als Verein türkischer Gastarbeiter, gegründet 1978 in Berlin-Kreuzberg. In der Vereinsgeschichte ginge es sportlich zum Teil sehr erfolgreich zu, so stieg man unentwegt bis in die höchsten Berliner Spielklassen und dann sogar in die bundesweiten Ligen auf. Neben den zahlreichen Fans und Unterstützern des Vereins gab es jedoch auch leider immer wieder Rückschläge und Probleme. Zwei große Schwierigkeiten sind bis heute geblieben: Auf der einen Seite gibt es immer wieder rechtsextreme und rassistische Anfeindungen gegenüber dem Verein, Funktionären und Spielern – auf der anderen Seite waren und sind viele Vereinsfunktionäre aus der türkischen Community und hatten und haben damit strukturelle Probleme bei der Platzbeantragung, der deutschen Vereinsmeierei und –organisation, was den Kreuzberger Verein immer wieder hinderte schnell weiter voranzukommen. Heute ist der Verein gelebte Akzeptanz im Kiez und schon lange finden nicht mehr nur türkische Arbeiter den Weg zu Türkiyemspor, sondern Menschen aus allen Facetten des gesellschaftlichen Lebens mit nahezu allen Lebensrealitäten. Neben dem Platz engagiert man sich in sozialen Initiativen, organisiert und beteiligt sich an Bündnissen gegen Homophobie und sammelt aktuell Geld, um einer drohenden Insolvenz zu entkommen.
Kevin von Tennis Borussia berichtete über die frühe Gründung als Tennis- und PingPong-Verein, welcher bereits im 2. Vereinsjahr eine Fußballabteilung erhielt, welche binnen kürzester Zeit zur stabilsten und erfolgreichsten Abteilung heranwuchs. Aufgrund einer überdurchschnittlichen Beteiligung jüdischer Spieler und die darauffolge Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der Vereinsmitglieder durch die Nationalsozialisten befand man sich jedoch bald in der Bedeutungslosigkeit. Erst nach den Kriegszeiten wuchs TeBe wieder zu einem der großen Vereine Berlins heran. Leider verpasste man immer in den entscheidenden Jahren den Anschluss an die höheren Ligen. Nebenbei erzählte Kevin spannende Anekdoten aus der nunmehr über 100-jährigen Vereinsgeschichte. Beispielsweise wie der ehemalige jüdische Präsident Hans Rosenthal sich vorstellte, dass sich Hitler im Grabe umdreht, da er in der Führerloge des Olympiastadions saß. Aktuell sind die „Pfeilchen“ (aufgrund der Vereinsfarben lila-weiß) in der Berliner Oberliga anzutreffen und bringen seit einiger Zeit die eigene Kampagne „Fußballfans gegen Homophobie“ voran und in die Stadien quer durch Europa.
Der jüngste Verein in der Vorstellungsrunde, der Rote Stern Berlin 2012, gründete sich erst im April diesen Jahres, da einige Mitglieder eines anderen Roten Stern Vereins dort nicht mehr sonderlich glücklich waren. Ein weiterer Grund war die Fokussierung auf Denksportarten wie zum Beispiel Schach, Skat und Backgammon und die Arbeit im Weddinger Kiez mit zahlreichen Jugendlichen aus sozial- und strukturschwachen Familien. Darüber hinaus organisierte der Verein sportpolitische Veranstaltungen, zum Beispiel mit dem kleinsten Schiedsrichter Deutschlands, um über diverse Formen von Diskriminierung zu aufzuklären. Als nächstes folgt eine Veranstaltung zur jüdischen Geschichte im deutschen Sport, sowie Film- und Hörspielabende zu ausgesuchten Werken. Aktuell werden u.a. die Kampagnen „love sports – hate neonazism“ und das „Bündnis Mitte gegen Rassismus“ unterstützt.
Nach der Eigenvorstellung der Vereine wurde in eine offene Diskussions- und Fragerunde eingestiegen. Eröffnet wurde diese mit der Frage nach anderen ähnlichen Vereinen in der Bundesrepublik. Tennis Borussia ist einzigartig in Deutschland – und bislang gibt es keinen anderen Verein, der sich ähnlich nennt und ein ähnlich breites Angebot und Engagement an den Tag legt. Von Türkiyemspor gibt es mehrere gleichnamige Vereine verteilt in der gesamten Republik. Aktuell bestehen Bestrebungen, sich mit einem Türkiyemspor–Verein in Nordholland wieder fester auszutauschen. Der Rote Stern berichtete, dass noch mind. 24 weitere Rote Stern Vereinigungen bestehen welche sich durch vollkommen unterschiedliche Ausrichtungen und ganz unterschiedliches politisches Engagement definieren.
Ein Kernthema, welches alle drei Vereine für unheimlich wichtig befinden, ist aktive Arbeit gegen Diskriminierung und eintreten für gemeinsamen Spaß am Spiel, unabhängig von Herkunft, Ethnie, Religion, Sexualität. Manche nennen dies „Integration“, wobei hier Türkiyemspor dafür eintrat, nicht von Integration zu sprechen, da damit in der Mehrheitsgesellschaft nahezu immer Assimilation gemeint wird, ein Anpassen an eine, wie auch immer geartete „Deutsche Kultur“; es jedoch vielmehr um ein Zusammenspiel verschiedener Mentalitäten gehen sollte, eine Synergie.
Abschließend lässt sich sagen, dass alle drei Vereine eine erhöhte Daseinsberechtigung haben und sie sich aktiv in die sportpolitischen und gesellschaftlichen Konstellationen einbringen, um den Fußball diskriminierungsfreier zu gestalten.
Quelle haolam